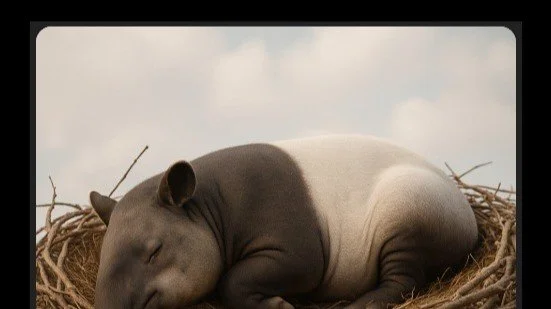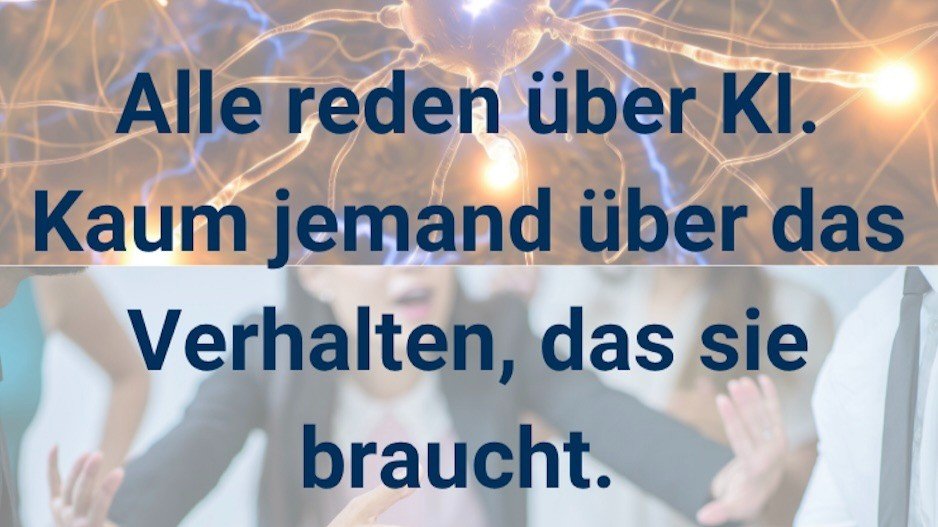Vom Umgang mit Blockierern im Unternehmen Oder: Was tun, wenn Tapire in Bäumen schlafen?
Wie überzeugt man Menschen, die in ihren Meinungen festgefahren sind?
Tapire sind faszinierende Tiere – entfernt schweineähnlich, aber näher verwandt mit Pferden und Nashörnern. Sie haben einen kleinen, charmanten Rüssel, ernähren sich vegetarisch und bevölkern die Erde seit über 14 Millionen Jahren.
Mein Tapir-Erlebnis vom Wochenende war allerdings weniger zoologisch als psychologisch: Es entstand im Rahmen des CAS Digital Leadership an der HWZ University of Applied Sciences in Business Administration Zurich. Unser Thema: der Umgang mit Populismus in Unternehmen - als Widerstandskraft gegen digitale Transformation.
Populismus – auch im Unternehmen allgegenwärtig
Wir sprachen darüber, ob es Sinn macht, mit Menschen zu diskutieren, die völlig resistent gegenüber Fakten sind. Beispiele gefällig? „Putin will doch nur Frieden.“ „5G macht uns alle krank.“ „Der Klimawandel ist erfunden.“ „KI soll die Menschen versklaven.“
Und diese Mechanismen finden wir auch in Unternehmen – nur mit anderen Parolen:
„Homeoffice macht alle faul.“ „KI ist gefährlich und nutzlos.“ „Wir haben keine Chance gegen die Grossen.“ „Die Chefs reden von Kultur, meinen aber Kontrolle.“ „In diesem Unternehmen wird sowieso nichts entschieden.“
Es gibt aber auch die Promptokratur, also den Glauben, das die komplexe Welt (etwa komplizierte IT-Projekte) sich durch geschickte Prompts einfach lösen liesse. So wie Alexander der Große den unlösbaren "Gordischen Knoten" einfach mit dem Schwert durchhackte.
Funktional sind das dieselben Muster wie im politischen Populismus:
Emotionale Vereinfachung („Früher war alles besser“ "Stell dich nicht so kompliziert an")
Feindbildbildung („die da oben / die anderen / die Technik“)
Entlastung durch Generalisierung („Man kann ja sowieso nichts machen“ "Du musst nur richtig prompten")
Sie schaffen kurzfristig Orientierung – aber zerstören langfristig Vertrauen und Handlungsspielraum.
Organisationale Mythen – soziale Funktion, gefährliche Wirkung
Diese Narrative wirken wie kleine „organisatorische Verschwörungstheorien“. Kurzfristig stabilisieren sie Teams durch ein gemeinsames Dagegensein:
Sie stiften Gemeinschaft („wir gegen die da oben“),
sie entlasten emotional in komplexen Veränderungsprozessen,
sie schützen den Selbstwert („ich bin nicht schuld – das System ist falsch“).
Langfristig aber polarisieren sie das Klima, lähmen Entscheidungsfähigkeit und erzeugen genau die Blockade, die sie beklagen.
Wie also umgehen – mit Populismus, privat wie beruflich?
Ob in Politik, Unternehmen oder Familie: Die Gegenstrategie ist immer dieselbe. Es geht um fünf Prinzipien, die Reaktanz auflösen und Vertrauen aufbauen:
Die 5 Prinzipien im Umgang mit Populismus
1️⃣ Nicht korrigieren. Widerspruch stabilisiert das Weltbild – und verstärkt Polarisierung.
2️⃣ Nicht spiegeln. Kein Spott, keine Empörung – das schafft Ruhe und entzieht die Bühne.
3️⃣ Interesse zeigen. „Spannend – woher kommt das Bild?“ statt „Das stimmt nicht.“
4️⃣ Ruhig zurück zur Realität führen. Sachlich einordnen, nicht emotional reagieren – das stabilisiert das Umfeld.
5️⃣ Für Umstehende Haltung zeigen. Nicht gegen, sondern für etwas sprechen. Du redest nicht mit den Populist:innen, sondern mit den Vernünftigen, die zuhören.
Druck erzeugt Gegendruck. Wer moralisiert, provoziert Widerstand. Wer ruhig erklärt, ernst nimmt und Verantwortung teilt, schafft Offenheit – nicht Abwehr.
Der Anteil der „Blockierer“
Die stark anti-institutionelle Gruppe ist in Unternehmen selten grösser als 10 bis 15 %. Die kooperationsfähige Mitte umfasst dagegen 60 bis 65 % der Mitarbeitenden.
Diese Gruppe will verstehen, sucht Orientierung und Dialog. Je ruhiger und transparenter kommuniziert wird, desto grösser die Chance, diese Mitte für Veränderung und Transformation zu gewinnen.
Beispiel: Einführung von KI
Ein mittelgrosses Unternehmen führt KI-gestützte Tools in Vertrieb und Administration ein. Die Ziele: Effizienz, Qualität, Innovationsfähigkeit.
Wahrnehmung der Mitarbeitenden:
Hohe Komplexität
Unklarer Nutzen
Angst vor Arbeitsplatzverlust
Kommunikation sachlich, aber distanziert
Das Ergebnis: Unsicherheit, Misstrauen, Gerüchte. In dieser Phase entstehen vereinfachte Erzählungen:
„KI wird uns alle ersetzen.“ „Das ist wieder so ein Management-Hype.“ „Wir werden damit überwacht.“
Solche Aussagen sind rein atmosphärisch. Fakten wirken hier nicht – sie verstärken nur den Widerstand. Spielen wir es also einmal durch, wie könnten Digital Leader auf diese Verschwörungen reagieren.
Ein Beispiel aus einem Forum zur KI-Einführung:
Populist: „Diese ganze KI-Geschichte ist doch nur dazu da, uns zu überwachen. Bald wissen die da oben jeden Klick!“
Führungskraft (L):
1️⃣ Nicht korrigieren: „Ich verstehe, dass das so wirken kann.“
2️⃣ Nicht spiegeln: „Das ist ein wichtiges Thema – lassen Sie uns kurz anschauen, warum das so empfunden wird.“
3️⃣ Interesse zeigen: „Was löst bei Ihnen diesen Eindruck aus? Gab es ein konkretes Beispiel?“
4️⃣ Ruhig zurück zur Realität führen: „Tatsächlich speichert die KI nur Projektdaten, um Routinen zu erkennen – nicht, um Personen zu bewerten. Wir prüfen das gemeinsam, Schritt für Schritt.“
5️⃣ Für Umstehende Haltung zeigen: „Mir ist wichtig, dass wir mit der Technologie verantwortungsvoll umgehen – sie soll uns entlasten, nicht kontrollieren.“
Das Ergebnis: Der Populist bekommt keine Bühne, das Team spürt Ruhe, Orientierung und Dialogbereitschaft – und genau das gewinnt Vertrauen.
Der Tapir im Storchennest
Eine Teilnehmerin erzählte von einem Zoobesuch. Neben ihr stand eine Mutter, die ihrem Kind erklärte:
„Der Tapir klettert abends ins Storchennest, um dort zu schlafen.“
Wie soll man damit umgehen – korrigieren oder schweigen?
Daneben stand eine andere Frau – nennen wir sie Clara. Clara wollte eingreifen, ohne jemanden bloßzustellen.
Claras 5 Schritte im Zoo
1️⃣ Nicht korrigieren: „Oh, das hab ich ja noch nie gehört – das klingt originell!“
2️⃣ Nicht spiegeln: (freundlich) „Das ist ja ein spannendes Bild, Tapire auf Ästen – ich seh’s direkt vor mir.“
3️⃣ Interesse zeigen: „Wie schön, dass ihr euch so viele Tiere anschaut! Tapire sind ja wirklich besonders.“
4️⃣ Ruhig zurück zur Realität führen: „Ich glaub, Tapire mögen’s lieber unten, wo’s kühl ist – aber das Bild ist wirklich nett. Vielleicht träumt der Tapir im Nest ja nur?“
5️⃣ Für Umstehende Haltung zeigen: „Wie schön, wenn man so fantasievoll über Tiere spricht – und gleichzeitig Neues lernt.“
Clara spricht nicht gegen die Mutter, sondern für das Klima. Sie zeigt, dass man Dinge richtigstellen kann, ohne jemanden klein zu machen. Dass Wahrheit und Würde sich nicht ausschliessen – sondern ergänzen.Abgedeckte Fälle + Start-/Endpunkte (Belege)
Anzahl der Länder mit Populisten in der Regierung seit 2020:
Take Away
Leadership zeigt sich nicht im Rechthaben (auch wenn es sich gut anfühlen mag) – sondern im ruhigen Umgang mit Irrtümern.
Am Ende haben wir sogar ChatGPT überredet, uns die Geschichte zu glauben. Das Ergebnis im Foto anbei.
Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche – und vielleicht den klaren Blick auf den nächsten Tapir im Baum.
🩵 Herzliche Grüsse, Alexis
Wie bringen wir die KI-Einführung zum Fliegen?
Es beginnt alles mit einer Idee.
Was hindert uns eigentlich daran, die Potenziale neuer Technologien zu nutzen – aus einer zutiefst menschlichen Perspektive?
Alexis Johann
Leading Behavioral Designer & Applied Economist👨🎨, Trusted Advisor & Inspirational Speaker - Transformation, Leadership & Management
October 7, 2025
Es begann ganz unscheinbar – mit einer leeren Zeile.
„Suche“ stand in dem Fenster, ganz allein - sonst keine störenden Links. Und zum ersten Mal in der Geschichte konnten Menschen Wissen selbst finden – statt darauf zu warten, dass es ihnen erklärt wird. Die Suchfunktion im Internet Ende der Neunziger Jahre brachte zwar ein neues Tool, aber vor allem ein neues Prinzip: Nicht warten, dass jemand sagt, was zu tun ist. Sondern: Jede Antwort beginnt mit einer Frage – und diese Frage stelle ich.
Dann kam das Smartphone – und mit ihm die ständige Erreichbarkeit. Später Social Media – und mit ihr das Gefühl, jederzeit alles sehen, hören, sagen zu können.
Jede dieser Technologien hat nicht nur unseren Alltag verändert, sondern auch unser Verhalten. Unsere Muster. Unsere Rollen.
Und immer folgte dasselbe Muster: Erst kam das Staunen. Dann kam die Überforderung. Und dann: der Wendepunkt, der über Erfolg oder Misserfolg von Organisationen entscheidet.
Verändert das Werkzeug uns – oder verändern wir uns mit dem Werkzeug?
Im Bereich KI stehen wir jetzt genau an dieser Schwelle.
Die Zahlen zeigen: Es passiert etwas
Zwei Drittel der Menschen in der DACH-Region nutzen bereits KI bzw. Large Language Models wie Copilot, ChatGPT oder Gemini im beruflichen Kontext. Und laut Bitkom (2025) setzen 36 % der Unternehmen in Deutschland aktiv KI ein – fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Aber: Nur 8 % der Unternehmen schulen alle Mitarbeitenden. Und 43 % bieten gar keine Schulungen an.
Die Nutzung wächst schneller als die Kompetenzen.
Warum? Ganz einfach: Weil die Budgets für Re-Skilling seit zehn Jahren stagnieren, während die Anforderungen explodieren. Ein riesiges Loch tut sich also auf – und das hat Konsequenzen.
Vor ein paar Wochen begleitete ich eine Führungskraft, die offen über ihre KI-Initiativen sprach. Man habe Copilot ausgerollt, Prompting-Workshops angeboten, erste Use Cases umgesetzt. Einige Mitarbeitende hatten sogar eigene Automatisierungen gebaut.
„Es läuft gut“, sagte er. Doch dann – ein kurzer Moment der Stille. Dann der Satz, der mir geblieben ist:
„Aber ehrlich gesagt – ich weiß nicht, ob sich bei uns wirklich etwas verändert hat. Ob es uns als Firma in dieser schwierigen Situation wirklich weiterhilft.“
Lernen findet statt – aber nicht dort, wo es wirkt
Was dieser Manager beschrieb, war keine Tool-Kritik. Er hatte auch keine Zweifel daran, dass die Mitarbeitenden sich über den Zugang zu Copilot freuen. Vielleicht kommen sie dadurch sogar ein bisschen lieber zur Arbeit.
Was fehlt, ist etwas Fundamentales:
Systematisches Teilen von Wissen
Lernen über Bereichsgrenzen hinweg
Dialog darüber, was funktioniert – und was nicht
Bewusstes Weiterentwickeln von Routinen
Das ständige Verfeinern von Prozessen – essenziell für Produktivität
Es ist ein vertrautes Muster: Neue Technologie trifft auf alte Verhaltenslogik.
Ich habe das schon einmal erlebt
Von 2000 bis 2015, als Medienmanager in einer Branche, die von Digitalisierung überrollt wurde. Damals: viel verspielte Begeisterung für das Neue – aber eine intuitive Blockade vor der tiefgreifenden Verhaltensveränderung, die echte Innovation erfordert hätte.
Das war die Chance für die späteren Big Techs – und die damaligen Start-ups. Sie hatten keine alten Zöpfe – also mussten sie auch keine abschneiden. Sie konnten auf der grünen Wiese bauen, während die etablierten Unternehmen ihre Legacy diskutierten.
Und heute? Mitarbeitende nutzen KI – aber die Organisation verändert sich nicht.
KI wird schnell angenommen – aber langsam integriert
In der Theorie ist alles da:
Mehr Effizienz
Weniger Routine
Neue Möglichkeiten
Aber in der Realität:
Die Tools werden in der Kaffeeküche diskutiert – nicht im Managementmeeting
Jede Abteilung bastelt eigene Lösungen – ohne Abgleich
Führungskräfte sehen „gute Stimmung“ – aber erzeugen keine strukturelle Wirkung
Die Menschen profitieren – aber die Organisation bleibt stehen.
Der wahre Engpass ist kein Tool – es ist Verhalten
Wir bei FehrAdvice sehen es immer wieder: Je schneller die Technologie, desto deutlicher wird: Organisationen lernen zu langsam. Und Lernen heißt nicht: „Ich weiß, wie das Tool funktioniert.“
Lernen heißt:
Ich ändere mein Verhalten
Ich arbeite anders mit Kolleg:innen zusammen
Ich erkenne implizite Muster – und breche sie auf
Doch genau das passiert oft nicht.
Ein Beispiel aus einem Kundenprojekt
Ein Unternehmen wollte seine KI-Initiativen skalieren. Es gab beeindruckende Pilotprojekte – automatisierte Analysen, Prozessbeschleunigungen.
Aber dann das Bild, das wir oft sehen:
Die Learnings aus den Piloten wurden nicht weitergegeben.
Andere Teams wiederholten dieselben Fehler.
Niemand wusste genau, was bereits ausprobiert worden war.
Ein Mitarbeiter brachte es auf den Punkt: „Ich weiß, dass wir viel machen – aber ich weiß nicht, was davon gut ist.“
Was dann passiert, ist vorhersehbar: Die ersten Fortschritte versanden. Mythen über nicht funktionierende Tools machen die Runde. Aus der Euphorie wird stille Enttäuschung.
Nicht, weil Copilot versagt hätte – sondern, weil eine Verhaltensarchitektur fehlte. Und jede:r, der diese Dynamik erkennt, sollte sich jetzt fragen:
Wie schaffe ich systematische Verhaltensveränderung in meinem Team – sodass schnelles Lernen, Zusammenarbeit und Skalierung möglich werden?
Nicht irgendwann. Sondern jetzt.
Genau dort setzt BEATRIX an
Das Beratungsunternehmen FehrAdvice & Partners hat BEATRIX entwickelt, weil Trial & Error in vernetzten Organisationen nicht mehr reicht. BEATRIX ist eine Behavioral Intelligence Suite – ein Werkzeug, das Verhalten erklärbar und gestaltbar macht.
Es zeigt:
Wo Verhalten blockiert
Wie Vertrauen entsteht
Wann Lernen gelingt
BEATRIX simuliert Verhalten bevor es geschieht – und gibt damit Orientierung, bevor Systeme kippen.
Und das Beste: Es funktioniert in der Sprache, die alle schon sprechen – über Large Language Models, eingebettet in die Dialoglogik moderner KI.
Was sich mit BEATRIX verändert
In Unternehmen, die BEATRIX einsetzen, beobachten wir:
Weniger Reibungsverluste durch unklare Diskussionen (z. B. in Strategie, Transformation oder Marketing)
Mehr Resonanz zwischen Bereichen
Schnellere Adaption von Neuem
Klarere Erwartungen an Menschen – und damit mehr psychologische Sicherheit
Warum? Weil Führung nicht mehr auf Mutmaßungen basiert („Ich glaube, wir sind offen genug“) – sondern auf echter Verhaltensdiagnose und Simulation. Weil BEATRIX Argumente liefert – und Klarheit.
Fazit: KI kann viel. Aber ohne Verhaltensarchitektur bleibt sie Einzelarbeit
Organisationen sind keine Maschinen. Sie lassen sich nicht per Update transformieren. Wenn wir wollen, dass KI wirkt, müssen wir bereit sein, unser Verhalten zu verändern. Nicht nur „wollen“, sondern Strukturen schaffen, die das Neue sichtbar, verstehbar und erlebbar machen.
Ich habe es selbst erlebt – als Manager, als Berater: Veränderung ist mühsam, steinig, oft mit Widerständen und Fehlern verbunden. Aber die gute Nachricht: Es kann auch leicht sein – wenn man das richtige Werkzeug hat.
BEATRIX ist genau dafür gebaut: Um Verhalten verstehbar zu machen, bevor die Zeit zum Handeln knapp wird.
Nächster Schritt?
Ich bin überzeugt: Die nächste Phase der KI-Reise beginnt mit einer ehrlichen Frage:
Was hindert uns – nicht technisch, sondern menschlich?
Wenn du spürst, dass „Tool-Wissen“ in deiner Organisation nicht mehr reicht, dann ist ein Gespräch mit uns vielleicht der nächste notwendige Schritt. Wir können helfen.
Und noch ein Punkt, der oft übersehen wird: das Budget.
Viele Unternehmen sagen heute: „Wir würden ja gern mehr in Re-Skilling investieren – aber uns fehlen die Mittel, um alle zu schulen.“
Und das ist Realität. Die Weiterbildungsbudgets haben sich seit Jahren nicht bewegt – während die Anforderungen explodieren.
BEATRIX kann hier ein echter Hebel sein. Denn es hilft, punktgenau zu erkennen, wo Schulungen wirklich nötig sind.
Nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip investieren
Sondern segmentspezifisch, verhaltensnah und bedarfsorientiert handeln
Ressourcen dort einsetzen, wo sie Wirkung zeigen – und wo die Organisation es wirklich braucht
Das spart nicht nur Geld, sondern schafft etwas noch Wertvolleres: Vertrauen in die Relevanz von Veränderung.
Auf der Welle der Erneuerung: reiten oder fallen - Warum Krisen Chancen bieten
Es beginnt alles mit einer Idee.
August 25, 2025
Zukunft gestalten in Zeiten permanenter Beschleunigung
In den letzten Wochen durfte ich viele intensive Gespräche führen – mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Führungskräften, mit Gründerinnen und Gründern. Was mich dabei bewegt: Überall spüre ich denselben Druck. Märkte sind unsicher, Kaufkraft schwindet, globale Krisen erzeugen eine Stimmung der Vorsicht. Gleichzeitig eröffnet sich ein riesiges Feld an Chancen durch Machine Learning, Large Language Models und digitale Fabriken.
Die zentrale Frage ist: Wie können wir Menschen und Organisationen auf dieser Reise mitnehmen?
Von Ideen, die tragen – und von denen, die verschwinden
Besonders eindrücklich war ein Gespräch mit einem Gründer, der wissen wollte, wie er verlässlich testen kann, ob potenzielle Kunden nicht nur Interesse an seinem Produkt zeigen, sondern auch bereit sind, dafür zu zahlen – etwa in einem Abo-Modell. Wird das funktionieren, hat die Idee ein Potenzial?
Natürlich gibt es viele ähnliche Angebote wie seines am Markt. Aber in einer Welt von KI und Automatisierung setzen sich nicht automatisch die Ersten durch, sondern diejenigen, die ihre Idee am konsequentesten umsetzen.
Die Geschichte zeigt uns das immer wieder:
Sergey Brin und Larry Page waren nicht die Ersten mit einer Suchmaschine. Aber sie hatten die beste Story – und ein einleuchtendes Modell, das die Intelligenz des Webs, die soziale VErnetzung für Menschen, für Google nutzbar machte.
Apple war in den 1990er Jahren fast in Vergessenheit geraten. Doch mit iMac, iPod und iPhone gelang es ihnen, Märkte neu zu definieren – weil sie verstanden, wo die Pain Points der Menschen lagen, und darauf ihre Innovation aufbauten.
Airbnb entstand mitten in der Weltfinanzkrise. Die Gründer wollten ursprünglich nur ihre Miete bezahlen, indem sie Matratzen in ihrer Wohnung vermieteten. Aus dieser Notlösung wuchs ein neues Geschäftsmodell, das Hotels herausforderte und eine ganze Branche veränderte.
Videokonferenz-Tools gab es längst – Skype, Teams, WebEx. Aber als die Pandemie kam, war Zoom das einzige Produkt, das skalierbar, zuverlässig und benutzerfreundlich genug war, um Millionen Menschen über Nacht ins Homeoffice zu bringen.
Was wir bei FehrAdvice tun – und was Sie tun können
Genau auf dieser Strecke begleiten wir Unternehmen. Im Gespräch mit Dejan Jovicevic, Gründer der Innovations- und Startup-Plattform Brutkasten, haben wir über ganz konkrete Hebel gesprochen, die heute den Unterschied machen:
1. Erzählen Sie eine klare Geschichte der Veränderung. Mitarbeitende und Kunden müssen verstehen, warum eine Veränderung passiert. Wer nur Regeln vorgibt („ab jetzt wieder alle ins Büro“) verliert Vertrauen. Wer aber erklärt, was dadurch besser wird, gewinnt Mitstreiter.
2. Testen Sie Akzeptanz und Zahlungsbereitschaft früh und evidenzbasiert. Ideen, Preise und Prototypen lassen sich heute viel schneller und präziser auf ihre Wirkung prüfen. Nur so entsteht Klarheit, ob ein Produkt im Markt wirklich greift.
3. Schaffen Sie Anreize statt Barrieren. Ob Homeoffice oder neue Tools – es reicht nicht, Erwartungen zu formulieren. Erfolgreiche Unternehmen setzen Anreize, die Nutzen stiften: Zeitersparnis, bessere Zusammenarbeit, spürbarer Mehrwert.
4. Fördern Sie Fehler- und Feedbackkultur. Innovation braucht Sicherheit, Dinge ausprobieren zu dürfen. Wenn Fehler sanktioniert werden, stirbt die Neugier. Wenn Feedback ernst genommen wird, entsteht Vertrauen – und genau dort beginnt echte Innovationsfähigkeit.
Ein persönliches Fazit
Auch mich bewegt dieser Umbruch. Ich bin überzeugt: Wir stehen an einem Punkt, an dem wir Gewohntes loslassen müssen, um Platz für Neues zu schaffen.
Und am meisten berührt hat mich in den letzten Tagen das Fazit eines Kunden-Workshops:
„Beim Thema KI sind wir alle Anfänger. Das ist schön und verbindend. Wir lernen alle – und das gemeinsam.“
Genau dieses Mindset brauchen wir: Offenheit, Mut und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren. Dann werden Krisen zu Phasen der Erneuerung.